« « Startseite | « Vom Wald zum Forst Vom Wald zum Forst
Anfänge der Forstgeschichte
|
Der Wald lieferte den Lebensunterhalt
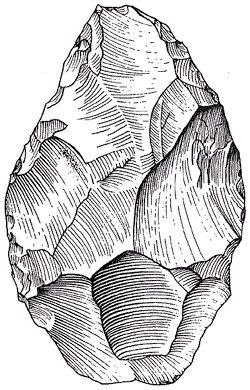
Vor einer halben Million Jahren wurde ein 17 Zentimeter langes Stück Feuerstein bearbeitet. Möglicherweise wurde der als »von Abbeville« bekannte Stein auch als Axt benutzt.
Die Spanne der Eiszeiten - etwa von einer Million bis 10 000 vor Christus - gehört menschheitsgeschichtlich zur Altsteinzeit. Das besagt: neben wenigen Gegenständen aus Holz, Knochen und Horn blieb uns aus jener Epoche nur Werkzeug aus Stein erhalten. Immerhin hatte der Mensch schon Werkzeug. Das vor allem ist es, was ihn von seinen Verwandten, den Affen, unterschied. Mit steinernen Waffen setzte er sich gegen die Tiere zur Wehr, tötete und zerlegte sie. Und mit steinernen Beilen fällte er Bäume.
Der Wald lieferte ihm den Lebensunterhalt - Beeren, Wurzeln, Pilze, Fleisch - und das Holz für Werkzeuge, für Schutzzäune und Lanzen sowie später, vermutlich erstmals vor etwa 500000 Jahren, auch fürs Feuer. Gleichzeitig aber war für ihn dieser Wald mit seinen reißenden Tieren, den stürzenden Bäumen und sumpfigen Böden eine stete Bedrohung. Dazu kam das Unheimliche der düsteren Urwälder, in deren Tiefen der primitive Mensch Geister und Dämonen wähnte. Bis ins späte Mittelalter galt der Wald als die Behausung von Trollen, Hexen und Kobolden. Als daran niemand mehr so recht glauben mochte, musste er als Versteck für allerlei Gesindel herhalten.
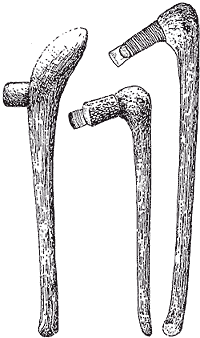 Steinzeitliche Beile bestanden aus einem zweckmäßig gewachsenen Ast und einem Steinbrocken mit geschärfter Schneide. Der Stein wurde zunächst nur in ein Astloch oder einen Spalt im Holz geklemmt. Später benutzte man auch Zwischenstücke aus Hirschhorn und zum Befestigen Lederriemen oder Tierdärme.
Steinzeitliche Beile bestanden aus einem zweckmäßig gewachsenen Ast und einem Steinbrocken mit geschärfter Schneide. Der Stein wurde zunächst nur in ein Astloch oder einen Spalt im Holz geklemmt. Später benutzte man auch Zwischenstücke aus Hirschhorn und zum Befestigen Lederriemen oder Tierdärme.
Sobald der Mensch die ersten Werkzeuge erdacht hatte, wurde er zum Waldarbeiter. Wann war das in unseren Breiten? Es ist schwer zu sagen. Die ältesten Werkzeuge, die man fand (und die nur deshalb als Werkzeuge erkannt wurden, weil sie bearbeitet waren), sind Faustkeile: Brocken aus Stein aus Feuerstein vor allem, die am einen Ende stumpf, am anderen spitz zugehauen waren. Sie dienten als Hiebwaffe, als Dorn, Beil und Messer - alles in einem. Aus der Epoche der drittletzten Zwischeneiszeit, also aus einer Zeit vor etwa 500000 Jahren, sind solche Faustkeile erhalten geblieben. Nur wenig jünger ist der sogenannte »Faustkeil von Abbeville«. Er ist ein Paradestück der vorgeschichtlichen Forschung. Ob er aber tatsächlich jemals zum Schlagen von Holz benutzt wurde (ob er also das erste uns bekannte, echte Waldarbeitsgerät der Geschichte ist), kann niemand mit Sicherheit sagen. Darüber streiten die Forscher noch.
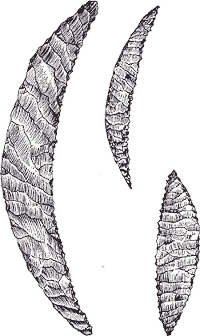 Diese sichelförmigen, sägenähnlichen Stücke aus Feuerstein hatten teils nur eine einzige Schneide, teils auch zwei. Der steinzeitliche Mensch benutzte sie als Erntemesser und möglicherweise auch zur Bearbeitung von Holz.
Diese sichelförmigen, sägenähnlichen Stücke aus Feuerstein hatten teils nur eine einzige Schneide, teils auch zwei. Der steinzeitliche Mensch benutzte sie als Erntemesser und möglicherweise auch zur Bearbeitung von Holz.
Bei den Funden aus der vorletzten Zwischeneiszeit (etwa vor 200000 bis 300000 Jahren) ist man schon sicherer. Hier sind es vor allem die Werkzeuge des Acheuleen - so benannt nach der Fundstelle bei St. Acheul in Frankreich -, mit denen die Prähistoriker Staat machen können. Auch bei anderen Werkzeugen aus jener Zeit scheint es sich tatsächlich um Äxte oder Beile gehandelt zu haben. Sie sind flach und leicht, besser gearbeitet als alles, was man vordem kannte, und außerdem fein geglättet. Manche dieser Geräte haben gleich zwei Schneiden.
Um dieselbe Zeit benutzten auch in China die Menschen schon Faustkeile - allerdings aus Geröllen. In Malaysia und Java wurden zu jener Zeit ebenfalls Steinbeile hergestellt. In Burma fand man aus dieser weit zurückliegenden Epoche auch Äxte aus versteinertem Holz. Die Menschen der letzten Zwischeneiszeit - etwa vor 130000 Jahren - waren bereits feine Leute. Sie trugen Fellkleider, schminkten sich am ganzen Körper und opferten Bärenschädel. Ihre Werkzeuge aus Stein und Knochen waren vielfältig und sehr gefällig gearbeitet. An der Form der Faustkeile hatte sich allerdings wenig geändert; es ist überhaupt erstaunlich, wie diese Werkzeuge eine halbe Million Jahre lang in der immer gleichen Form hergestellt wurden. Auch wir arbeiten im Grunde ja immer noch mit einer stählernen Ausgabe der steinzeitlichen Axt. Die bisher letzte Eiszeit dauerte bis um das Jahr 10000 vor Christus. Allerdings zog sich das Eis schon 10000 bis 15000 Jahre früher allmählich zurück. Damit begann die endgültige Bewaldung unseres Gebiets. Zuerst siedelten sich Birken an (man spricht von einer »Birkenzeit« um 17 000 vor Christus). Um das Jahr 10000 gab die Kiefer den Wäldern den Charakter; danach Fichten und Eichen; schließlich trat, gewissermaßen als Abgesang der Eiszeit, ein grundsätzlicher Klimaumschlag ein. Das trockene Landklima änderte sich zum feuchteren Seeklima. Unter diesen Bedingungen konnten sich auch Tannen und Buchen viel stärker ausbreiten.
Kurz vor dem Beginn unserer Zeitrechnung war Mitteleuropa mit riesigen Urwäldern bedeckt, die hauptsächlich aus hohen Buchen bestanden. Auf trockenem Boden wuchsen Kiefern und Birken. Dazwischen gab es ausgedehnte Eichenmischwälder, in denen auch Ulmen und Linden, Eschen und Ahorn, Eiben und Wacholder standen. Typisch und allgegenwärtig aber war der düstere, geschlossene, weglose Buchenhochwald. Ihn meinte der römische Historiker Tacitus, als er kurz nach der Zeitwende schrieb, Germanien habe in jenen Tagen nur aus schrecklichen Wäldern und öden Sümpfen bestanden. Das war allerdings gewaltig übertrieben. Schon 5000 Jahre vor Christus hatten die Germanen begonnen, Stücke des Urwalds zu roden, um Weiden und Äcker anzulegen. Denn die Familien und die Stämme wurden zusehends größer; man musste notgedrungen zu Ackerbau und Viehzucht übergehen. Die Rodetechnik jener Zeit war denkbar einfach: Bäumen, die für die Steinaxt zu stark waren, wurde rundum ein Streifen Rinde abgezogen; nach einiger Zeit starben sie ab, denn dadurch wurde die Nährstoffversorgung unterbrochen. Was stürzte, blieb liegen, War das Holz dürr genug, wurde es angezündet, und fertig war der Ackerboden, mit Asche frisch gedüngt. Natürlich trug solch ein Feld nur zwei, drei Jahre Frucht. Dann gab der Boden nichts mehr her, und man überließ ihn sich selbst. Er wurde Weideland, und schließlich nahm ihn der Wald wieder in Besitz. Von der Steinzeit bis zum frühen Mittelalter bestand die Waldarbeit vor allem im Roden. Es gab viel Wald - und er galt als Feind, der zurückgedrängt werden musste. Noch waren die natürlichen Kräfte des Waldes stärker als die Möglichkeiten des Menschen, dem Wuchern Einhalt zu gebieten. Stets bestand die Gefahr, dass der mühsam aufbereitete Ackerboden wieder überwachsen wurde.
Das Holz war auch nützlich - für Speere und Axtgriffe, für Pflüge und Werkzeug, zum Bauen und zum Brennen - aber dies allein war noch kein Grund, den Wald freundlicher zu betrachten. Lediglich die Eichen waren geschätzt, weil sie Futter für die Schweine lieferten. Alle anderen Waldbäume galten in erster Linie als lästig. Je mehr von ihnen beim Roden durch Feuer vernichtet wurden, desto besser. Dankbar genutzt wurde hingegen, was der Wald an essbarem Wild hervorbrachte. Die Jagd war bis ins Mittelalter ein Teil der Waldarbeit; das Wild war ein Produkt des Forstes, wie Wurzeln und Beeren. Jeder freie Mann, der eine Waffe tragen durfte, hatte auch das Jagdrecht. Man darf sich keine übertriebenen Vorstellungen vom Wildreichtum jener Zeit machen: Die Tiermengen, die sich heutzutage in unseren sorgsam gehegten Beständen tummeln, hätten sich unsere Urahnen nur im Schlaraffenland vorstellen können. In den forstlich nicht genutzten Wäldern des Balkans, die den deutschen Wäldern von damals etwa gleichen dürften, findet man auch heute nicht mehr als zwei bis vier Stück Hochwild auf 1000 Hektar.
Bei vielen frühen Völkern war Waldarbeit - zunächst also das Zurückdrängen des Waldes, das Roden - die selbstverständliche Pflicht aller Männer, neben dem Beschaffen von Fleisch und dem Kampf gegen Feinde. Das galt auch bei den Germanen. Persönliches Eigentum an Grund und Boden war zu jenen Zeiten unbekannt: alles Land, Wald und Feld, soweit man es nutzen konnte, gehörte jedermann. Später, mit fortschreitender Kultivierung des Bodens, änderte sich das; beim Ackerland bildeten sich nun individuelle Besitzverhältnisse heraus. Der Wald hingegen galt, wenn nicht eines Tages ein Adliger die Hand darauf legte und das Jagdrecht für sich beanspruchte, noch lange Zeit als Allgemeinbesitz. Vielerorts hat er sich so als Gemeinde- oder Stadtwald bis heute erhalten, und immer noch ist ein gewisses Allgemeinrecht am Wald - zum Beispiel das Begehen durch Spaziergänger und Wanderer - ganz selbstverständlich. Anders als heute, wo unsere Wälder Inseln in besiedeltem Gebiet darstellen, wirkten noch im frühen Mittelalter die meisten Dörfer wie Inseln in einem schier unabsehbaren grünen Meer. Der Wald, in dem weit verstreut die Ansiedlungen lagen, wurde nur am Rand genutzt. Man schlug Holz zum Bauen und Brennen; man rodete, um Ackerland zu gewinnen; man trieb das Vieh unter die Bäume, um es dort weiden zu lassen. Aber gleich hinter dem letzten Zaun begann schon der Urwald. Hier lag die »Mark« des Dorfes, seine Grenze. Was innerhalb der Mark lag, gilt noch heute im Sprachgebrauch als »Gemarkung«.
Der Begriff »Mark« (er hieß in der althochdeutschen Sprache noch »marcha«) hatte doppelte Bedeutung: er stand einerseits für »Grenze«, andererseits bezeichnete er den dichten Wald. Beides war damals in der praktischen Auswirkung das gleiche, der Wald bestimmte die Ausdehnungsmöglichkeiten eines Gemeinwesens. Später galt die »Mark« im Deutschen Reich auch ganz allgemein als Grenzland; da gab es die »Nordmark« (die spätere Mark Brandenburg) und die »Ostmark« (das spätere Österreich). Die dort residierenden Reichsbeauftragten hatten den Titel »Markgraf«, aus dem sich schließlich der französische »Marquis«, der italienische »Marchese« und ähnliche Titulaturen entwickelten. Von der Gemarkung leitet sich übrigens auch die »Markierung« ab, und von dieser führt ein direkter sprachlicher Weg zur Deutschen Mark. So eng war unsere Währung mit dem Wald verbunden.
Zurück zu den riesigen, unwegsamen Waldgebieten, zwischen den frühmittelalterlichen Dörfern. Sie waren Niemandsland, uninteressant. So kümmerte es keinen, als die Könige begannen, diese und jene Waldung mit ihrem »Bann« zu belegen. Darunter verstand man im Mittelalter nichts Schlimmeres als die königliche Regierungsgewalt, im Guten wie im Bösen, und im Bannwald war das Jagdrecht für den König reserviert - oder für einen Fürsten, dem er das Recht übertragen hatte. Nur diese Herren durften in den Bannwäldern auch Holz schlagen oder roden lassen, denn Fremde hätten das edle Wild vergrämen oder den Bestand verringern können. Meist beschränkte sich der Bann aufs Hochwild - auf Wild für die »hohe Jagd«, die Jagdbeute der hohen Herren. Das waren Hirsche, Wildschafe und -ziegen, Wildschweine, Bären, Wölfe und Luchse, dazu etliche Großvögel wie Adler und Kraniche. Niederwild - darunter auch Rehe und Hasen - blieb für das Volk. Die Begriffe Hoch- und Niederwild gibt es - ganz nebenbei - in der Jägersprache noch heute. Aber nach dem Reichsjagdgesetz von 1934 gehören zum Hochwild nunmehr nur noch Elche, Rot- und Damhirsche, Wildschweine, Gemsen, Steinböcke, Mufflons und das Auerhuhn.
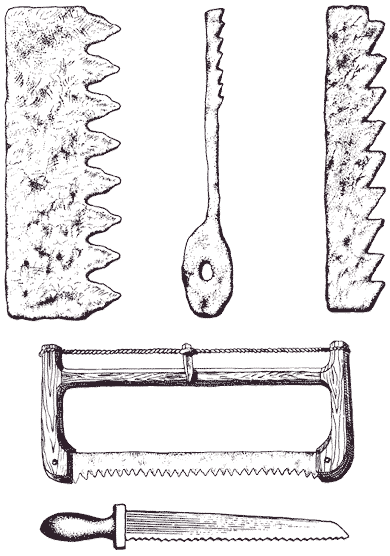
Um das Jahr 250 wurden in Germanien römische Sägen benutzt.
« Zurück: Vom Wald zum Forst