« « Startseite | « Vom Wald zum Forst Vom Wald zum Forst
Motorsägen
|
Mit Dampfmaschinen in die Wälder
Überhaupt misstrauten viele Techniker der Kette generell - sie verließen
sich lieber auf das gute alte Fuchsschwanzprinzip. Keiner von ihnen ahnte, Dass
es just jene scheinbar unsinnige Patentkombination des Mr. Jacob Smith aus Iowa
sein würde - eine Sägekette mit Führungsschiene -, welche die
Forstwirtschaft revolutionierte. Jede Motorsäge, die heute in irgendeinem
Wald der Welt zum Bäumefällen eingesetzt wird, arbeitet auf diese
Weise mit Kette und Schiene.
Damals jedoch, um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts, gab man dem Fuchsschwanzprinzip wie gesagt größere Chancen. Der erste, der (1860) eine vernünftige Idee hatte, das Hinundher-System im Wald wirtschaftlich zu realisieren, war der Engländer A. Ransome. Er stellte einen Dampfkessel auf eine Lichtung und führte Schlauchleitungen zu mehreren transportablen Sägen. Die hatten jeweils einen Zylinder, dessen sich hin- und herbewegender Kolben direkt mit einem Fuchsschwanz gekoppelt war, welcher sich waagrecht, senkrecht und schräg stellen ließ.
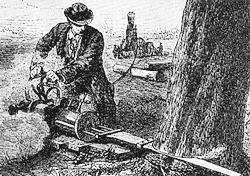 Das System des Ingenieurs A. Ransome wurde zwar schon 1860 in England entwickelt, aber erst 1879 eingesetzt - in den USA. Die Dampfmaschine,
welche die Antriebskraft liefert, ist durch Schläuche mit den Sägen
verbunden.
Das System des Ingenieurs A. Ransome wurde zwar schon 1860 in England entwickelt, aber erst 1879 eingesetzt - in den USA. Die Dampfmaschine,
welche die Antriebskraft liefert, ist durch Schläuche mit den Sägen
verbunden.
Das Prinzip war genial, aber es dauerte doch 19 Jahre, bis Ransomes Idee verwirklicht werden konnte. 1879 arbeitete eine solche Anlage erstmals in einem Wald in Oregon, USA. Im darauffolgenden Jahr stellte die Firma Koppel in Berlin Sägen nach dem Ransome-Prinzip her und fand auch Käufer. Im Prospekt hieß es:
Die Zähne der Säge sind so gestellt, Dass sie nur beim Rücklauf
des Kolbens schneiden, so Dass die Säge vermittels Zugkraft arbeitet. Bei
dieser einfachen Anordnung ist es möglich, Sägeblätter in Längen
von zweieinhalb bis drei Metern ohne Spannungsapparat anzuwenden.
Es ist wohl zu beachten, Dass das Sägeblatt vermöge der geschickten
Anordnung der einzelnen Teile jede beliebige Stellung annehmen kann. Man kann
daher die Maschine zum Fällen von Bäumen selbst an den steilsten Abhängen
anwenden und ebenso auch bereits gefällte Stämme mit derselben zerschneiden.
Jede Lokomobile kann den Dampf für diese Maschine liefern. Bei Bedarf können
bis zu vier solcher Sägen gleichzeitig - von einer Dampfmaschine gespeist -
nach verschiedenen Richtungen funktionieren.
Die Geschwindigkeit, mit welcher die Maschine arbeitet, ist eine sehr beträchtliche.
Wenige Minuten genügen, um einen Baum härtesten Holzes von größtem
Durchmesser zu fällen. Mit dieser Maschine ist man imstande, an einem zehnstündigen
Arbeitstag 40 Bäume größter Dimension zu Fall zu bringen.
Zur Befeuerung der Dampfmaschine ließ sich Abfallholz verwenden, also quasi das Nebenprodukt der eigenen Arbeit. Noch 20 Jahre später, um die Jahrhundertwende, lieferte eine Firma in Lüttich solche Maschinen an Missionsstationen im afrikanischen Kongogebiet.
Dieses Dampfsystem war zu jener Zeit das einzige, das den Namen »Motorsäge« verdiente. Im übrigen bemühte man sich um abenteuerliche Instrumente, die zumeist mit Menschenkraft funktionieren sollten. Da gab es ums Jahr 1880 mehrere »Reitsägen«, bei denen der Arbeiter - auf einem bockartigen Gestell sitzend - beinewippend das Sägeblatt in Gang halten musste Eine Wiener Firma baute eine »Express-Säge«, die »nur von einer Hand in Bewegung gesetzt zu werden« brauchte und »im Walde als auch auf Bau- und Zimmerplätzen in einer Sekunde aufzustellen« sein sollte, wie es hieß.
Es herrschte kein Mangel an »genialen« Erfindungen, die viel zu umständlich waren, um praktisch zu sein. Zur Bewegung ihrer zahlreichen Hebel und Mechanismen brauchten sie mehr Kraft, als nachher für das Sägeblatt übrigblieb. Es war, als hätten sich die kühnen Konstrukteure der ersten Sägemaschinen im 16. Jahrhundert aus den Gräbern erhoben, um erneut ihre souveräne Verachtung aller Regeln von Kraftaufwand und Leistung zu demonstrieren.
« Zurück: Das Fuchsschwanz-Prinzip und die Sägekette
